Expertin des Monats
Apr. 2008
DIin Dr.in Viktoria Weber
Dipl.-Ing. Dr. Viktoria Weber studierte Lebensmittel- und Biotechnologie and der Universität für Bodenkultur in Wien. Während ihrer Dissertation am Department für Chemie der Universität für Bodenkultur, wo derzeit auch ihr Habilitationsverfahren läuft, beschäftigte sie sich mit der Strukturanalyse von Glykoproteinen. Danach arbeitete sie als Post-doc am Institut für Tumorbiologie und Krebsforschung (Medizinische Universität Wien) an der funktionellen Charakterisierung von Hefeproteinen. Seit 1999 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Donau-Universität Krems, wo sie im Zentrum für Biomedizinische Technologie den Fachbereich Biochemie leitet. Ihr Arbeitsgebiet umfasst die Entwicklung und Charakterisierung bioverträglicher Adsorbermaterialien für die Blutreinigung. Seit 2003 ist sie stellvertretende Leiterin des Zentrums.
Interview
Sie arbeiten am Zentrum für biomedizinische Technologie an der Donau Uni Krems. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich aktuell?
Ich bin in der angewandten Forschung tätig und arbeite an der Entwicklung von Systemen für die extrakorporale Blutreinigung. Das ist die Blutreinigung außerhalb des Körpers wie z.B. die Dialyse. Bei Dialysepatienten, die ein chronisches Nierenversagen haben, werden die wasserlöslichen Giftstoffe über Diffusion oder Konvektion aus dem Körper entfernt. Bei gewissen Erkrankungen reichern sich im Blut aber auch Stoffe an, die nicht wasserlöslich sind und die daher nicht mittels Dialyse entfernt werden können. Die bekanntesten Beispiele dafür sind Leberversagen, Autoimmun-Erkrankungen oder die Blutvergiftung. Das ist jenes Gebiet, wo ich arbeite und forsche.
Wie schaut das konkret aus?
In unseren Blutreinigungssystemen wird zunächst das Patientenblut über einen Filter in eine Zell- und eine Plasmafraktion getrennt. Das Plasma, also die flüssigen Anteile des Blutes, das auch die zu entfernenden Stoffe enthält, wird in Kontakt mit Absorber-Materialien gebracht. Das Absorbermaterial ist so funktionalisiert, dass schädliche Substanzen aus dem Blut entfernt werden. Das gereinigte Plasma kommt zusammen mit den Blutzellen zurück in den Patienten. Mein Forschungsbereich ist die Entwicklung dieser Absorbermaterialien. In Krems wurde ein System zur Leberunterstützung entwickelt, welches schon auf dem Markt ist. Aktuell liegt unser Schwerpunkt darin, ein System für die Blutvergiftung - Sepsis - zu entwickeln.
Sie arbeiten sehr eng mit der Firma Fresenius Medical Care zusammen. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?
Ein gemeinsam entwickeltes System zur Leberunterstützung - das PROMETHEUS-System - ist, wie gesagt, bereits in der klinischen Anwendung. Wir sind jetzt zwar nicht mehr direkt mit der Weiterentwicklung dieses Systems beschäftigt, bekommen aber aus der klinischen Anwendung wichtige Rückmeldungen, die in neue Entwicklungen einfließen. Dies betrifft zum Beispiel die Bedienbarkeit des Gerätes oder die Bioverträglichkeit der verwendeten Materialien.
Wie weit sind sie mit Ihren Ergebnissen. Wie zeichnen sich Erfolge ab?
Erfolge in der Zusammenarbeit mit einer Firma zeichnen sich meist dadurch ab, dass die Firmen auch bereit sind, weitere Projekte zu fördern.
Im Gegensatz zur Grundlagenforschung unterliegt die angewandte Forschung anderen oder marktwirtschaftlichen Kriterien. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ich war vorher in der Grundlagenforschung an der Boku und an der Uni Wien beschäftigt. Für mich war es ein spannender Wechsel, in den angewandten Bereich zu gehen. Die Donau-Uni Krems steht für post-graduale Weiterbildung und angewandte industrienahe Forschung. Es gibt in unserem Bereich eine Mischung aus Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung. Ich persönlich möchte mir die wissenschaftliche Freiheit behalten, als Forscherin manchmal bei einem Thema mehr in die Tiefe gehen zu können. Wir haben da die Möglichkeit, diese Tätigkeiten durch nationale oder EU-Fördermittel zu finanzieren.
Wie groß ist Ihre Arbeitsgruppe?
Es gibt am Zentrum für Biomedizinische Technologie 4 Arbeitsgruppen, die sehr ineinandergreifen und intensiv zusammenarbeiten. Im gesamten Zentrum sind ca. 25 Leute beschäftigt. Meine Arbeitsgruppe besteht aus etwa 5 Personen, das schwankt mit der Zahl der DiplomandInnen und DissertantInnen.
Die medizinische Forschung ist oft von langen Entwicklungszeiten gekennzeichnet. Benötigen Sie in Ihrer Arbeit viel Geduld?
Man braucht für Enwicklungen im Medizinbereich einen langen Atem und es ist von Vorteil mit einer großen Firma zusammenzuarbeiten. Die Entwicklung und Umsetzung des Sicherheitssystems für unser neues Blutreinigungssystem zum Beispiel dauerte einige Jahre. Ohne die langjährige Unterstützung einer Firma tut man sich sehr schwer dabei.
Sie sind stellvertretende Leiterin des Zentrums. Wie schaut Ihr beruflicher Alltag aus?
Ich betreue Diplomandinnen und Dissertantinnen in mehreren Forschungsprojekten. Zu einem wesentlichen Teil meiner Zeit plane und bespreche ich Versuche mit unseren MTAs, Diplomandinnen und Dissertantinnen. Oft geht es auch um die Bewertung von Versuchsergebnissen bzw. um Fehlersuche. Einen weiteren wichtigen Teil nimmt das Schreiben von Projektanträgen - und auch von Projektberichten - ein.
Sind Sie auch in der Lehre tätig?
Ich halte im Sommersemester eine Vorlesung an der Boku und das freut mich sehr, weil ich dann wieder Kontakt mit den StudentInnen habe. Ansonsten betreue ich an der Donau-Uni Diplomarbeiten und Dissertationen. Es gibt am Campus Krems auch eine Fachhochschule mit einem Biotechnologie-Zweig, wo ich DiplomandInnen betreue.
Sie betreuen ausschließlich weibliche Diplomadinnen - woran liegt das?
Wir haben einen sehr hohen Frauenanteil im Zentrum und dass ich aktuell nur Diplomandinnen betreue, hat sich einfach so ergeben.
Ist ihre jetzige Tätigkeit ein klassischer Beruf für die Studienrichtung Lebensmittel- und Biotechnologie?
Ich glaube, es gibt keinen klassischen Beruf für diese Studienrichtung. Die AbsolventInnen finden sich in vielen Bereichen. Als ich studiert habe, wurde das Studium von Gärungstechnologie gerade auf Lebensmittel- und Biotechnologie umbenannt. Damals standen die Lebensmittelfächer wie z.B. Milch-, Getreide- und Brauereitechnologie noch sehr im Vordergrund. Die StudentInnen haben gemäß der breiten Ausbildung eine breite Wahlmöglichkeit in ihrer Berufszugehörigkeit. Bei mir hat sich der Weg in die rote Biotechnologie mit einem starken Medizinbezug entwickelt.
Warum haben Sie sich für diese Studienrichtung entschieden?
Das war eine Last-Minute-Entscheidung. Ich habe immer gewusst, dass mich die Naturwissenschaften interessieren. Meine Eltern und Großeltern haben mir die Liebe zur Natur mitgegeben. Darum wollte ich eigentlich Pharmazie studieren. Bei einem Praktikum vor dem Studium in Seibersdorf habe ich eine Biotechnologiestudentin kennengelernt. Sie hat mir dann das Studium schmackhaft gemacht und ich habe mich in letzter Minute für Biotechnologie entschieden.
Haben Sie Ihre Eltern bei dieser Wahl unterstützt?
Meine Eltern haben mir, wie gesagt, die Begeisterung und Freude an der Natur mitgegeben und mein Vater hat mit uns Kindern chemische Experimente gemacht. Wir hatten auch ein Mikroskop, das war unser Spielzeug.
Wie würden Sie Ihren Beruf jungen SchülerInnen schmackhaft machen?
In der Volksschulklasse meines Sohnes haben die Eltern einmal ihre Berufe vorgestellt. Dort habe ich einen halben Tag mit den Kindern experimentiert und ich war begeistert, mit welcher Freude kleine Kinder durch ein Mikroskop schauen und staunen können. In diesem Alter kann man den Kindern sehr viel mitgeben. Ich versuche das auch bei meinen Kindern. Sie kriegen allerdings mit, dass ich sehr oft vor dem Computer sitze und ihre Vorstellung von meinem Beruf ist mitunter anders als die Realität.
Sie haben vor kurzem ihre Habilitation an der Boku eingereicht. Was ist die Motivation eine Habilitation zu machen?
Ich merkte, dass eine Habilitation für die berufliche Anerkennung wichtig ist. Das war sicher ein Motiv. Ein weiterer Grund war, dass ich mich mit einem bestimmten Thema sehr vertieft auseinandersetzen konnte. Ich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe.
Sie haben zwei Kinder im Alter von 12 und 10 Jahren und waren mehr als drei Jahre in Karenz. Wie war der berufliche Wiedereinstieg für Sie?
Ich habe mich bewusst dafür entschieden, die erste Zeit bei meinen Kindern zu verbringen und nicht gleich wieder arbeiten zu gehen. Ich habe nach meiner Karenz mit 10 Stunden zu arbeiten begonnen. Ich bin am Abend und am Samstag - wenn mein Mann nach Hause gekommen ist - ins Büro gegangen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung und bringt aus meiner Erfahrung nach viel für die späteren Jahre der Kinder. Wir können uns in unserer Familie sehr aufeinander verlassen.
Wie organisieren sie Ihren Alltag oder welche Unterstützung haben Sie jetzt?
Ich habe großes Glück, dass ich sehr nahe am meinem Arbeitsplatz wohne und auch die Schulen der Kinder in der Nähe sind. Mein Mann ist beruflich viel unterwegs und die Alltagsorganisation liegt daher hauptsächlich bei mir. Beide Omas waren sehr hilfreich in den ersten Jahren und sind es noch immer. Zusätzlich gibt es in Niederösterreich viele Initiativen, wie z.B. die "Mobilen Mamis", bei denen zum Beispiel ausgebildete Kindergärtnerinnen die Kinder zu Hause betreuen. Dieses Angebot haben wir in den ersten Jahren beansprucht.
Was macht ihr Mann beruflich?
Mein Mann ist auch Biotechnologe und er arbeitet für die Firma Fresenius. Wir haben uns beim Studium kennengelernt. Seine Tätigkeit liegt im Marketingbereich. Der ähnliche Hintergrund hat den Vorteil, dass wir unseren Beruf gegenseitig gut akzeptieren können.
Sehen Sie sich als Role Model - gerade im Hinblick auf Vereinbarkeit?
Studentinnen sprechen mich öfters auf dieses Thema an: "Ist es überhaupt gut, wenn ich Kinder bekomme?" oder "Wie kann ich dann wieder zurück in den Beruf?" Ich versuche Ihnen zu vermitteln, dass es einen Weg gibt. In unserem Zentrum haben fast alle MitarbeiterInnen Kinder und dadurch gibt es viel Verständnis und Toleranz, auch von Seiten unseres Chefs. Es steht natürlich die Arbeit und Leistung im Vordergrund, aber es findet sich immer ein Weg. Für mich war es nie ein Problem, einen Tag zu Hause zu arbeiten, wenn die Kinder krank waren. Diese Toleranz findet man nicht überall und vielleicht ist das auch nicht im jedem Beruf möglich. Ich glaube, es ist für die Leute motivierend zu sehen, dass sich Arbeit und Kinder vereinbaren lassen.
Ist die Förderungen von Frauen in der Technik aus Ihrer Sicht notwendig?
Im Augenblick wird in diesem Bereich sehr viel getan und ich empfinde das als sehr wichtig. Ich sehe aber auch, dass es manchmal ein bisschen belächelt wird. Gerade darum ist es aus meiner Sicht wesentlich, dass bei allen Maßnahmen Qualität und Leistung im Vordergrund stehen.
Programme wie FEMtech oder Forschung macht Schule finde ich wesentlich, weil sie helfen, Mädchen schon in ganz jungen Jahren für das Thema Naturwissenschaft zu begeistern.
Sie sind als Nachwuchswissenschafterin zum Nobelpreistreffen nach Lindau geschickt worden? Wie war das?
Ich war zwar eine der ältesten Nachwuchswissenschafterinnen dort, aber das Treffen war sehr spannend. Ganz eindringlich in Erinnerung habe ich Craig Mello, der vor 2 Jahren den Nobelpreis in Chemie bekommen hat. Er ist ein Forscher mit Pop-Star Auftritt. Es war eine spannende Erfahrung zu sehen, wie die Leute von einem Thema begeistert sind. Diese Freude an der Wissenschaft war der gemeinsame Nenner der Veranstaltung.
Was ist Ihr berufliches Ziel? Was wollen Sie noch erreichen?
Das erste kurzfristige Ziel ist, die Habilitation abzuschließen. Dann möchte ich mich gerne für ein Laura Bassi Centre bewerben. Es wäre ein schönes Ziel in den nächsten Jahren so ein Zentrum zu leiten, weil es uns ermöglichen würde, in unserem interdisziplinären Team an einem gemeinsamen Thema zu arbeiten.
Danke für das Interview!
Das Interview führte: DIin Inge Schrattenecker
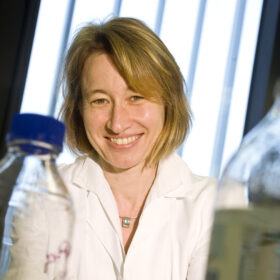
Donau-Universität Krems, Zentrum für Biomedizinische Technologie
Kontakt
Letzte Aktualisierung: 05.05.2023


















