Expertin des Monats
Nov. 2009
Dr.in Barbara Stadlober
Mag.a Drin Barbara Stadlober von JOANNEUM RESEARCH ist FEMtech Expertin des Monats November.
Nach ihrem Physikstudium an der Karl-Franzens-Universität Graz promovierte sie im Oktober 1995 am Walther-Meissner-Institut für Tieftemperaturforschung der Technischen Universität München.
Seit März 2009 ist sie Principal Investigator und Leiterin der Forschungsschwerpunkte "Organische Elektronik" am Institut für Nanostrukturierte Materialien und Photonik der JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft in Weiz. Zu ihren aktuellen Arbeitsgebieten zählen die organische Elektronik, Optoelektronik, Sensorik sowie Nanotechnologie.
Für die Wissenschafterin und zweifache Mutter sind folgende Dinge wichtig, um junge Frauen für eine Berufslaufbahn im naturwissenschaftlich-technischen Umfeld zu motivieren: eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre, erfolgreiche weibliche Role Models, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Förderung des Selbstvertrauens durch Tätigkeiten mit Verantwortung sowie Vorgesetzte, die Genderaspekte ernst nehmen und gezielt berücksichtigen.
Interview
Sie sind in ein Mädchengymnasium gegangen und erwähnen es in Ihrem Lebenslauf. Hat das eine Rolle bei Ihrer Studienwahl gespielt?
In gemischten Klassen bewegt man sich häufig in vorgefertigten Rollenmodellen - Mädchen sind gut in Sprachen, Burschen gut in Mathematik. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Alter das Selbstbewusstsein gehabt hätte, mein Interesse für Technik zu artikulieren, wenn Burschen in der Klasse gewesen wären, die mit Technik viel natürlicher umgehen. Wir hatten überdies eine gute Physiklehrerin. Wir haben zu viert oder fünft mit ihr am Nachmittag Praktika gemacht.
Als Freifach?
Wir haben uns einfach mit ihr verabredet. Wir haben Radios gebastelt und gelötet. Es hat mich sehr angesprochen, experimentell zu arbeiten. Die Lehrerin hat im Unterricht viel über Kosmologie und Astronomie erzählt - viele Mädchen hat das gelangweilt, doch ein paar sind in ihre Richtung gegangen.
Waren Sie gut in Mathematik?
Ja, ich war gut, aber mindestens ein Drittel der Klasse war gut in Mathematik. Und Mathematik war für die Klasse nie ein Hassfach.
Was machen Ihre Eltern beruflich?
Meine Mutter war Hauswirtschaftslehrerin. Ich bin die Älteste von fünf Kindern - nach dem zweiten Kind hat sie ihren Beruf nicht mehr ausgeübt. Mein Vater hat Landwirtschaft an der Boku studiert, aber dann jahrzehntelang als leitender Key Account Manager bei IBM gearbeitet. Später hat er ein eigenes Softwareunternehmen gegründet.
Hat er Sie in Richtung Technik beeinflusst?
Nicht direkt. Vielleicht indirekt. Er hat nie Einfluss genommen, und ich habe mich immer sehr selbständig entwickelt. Ich habe allerdings zuerst ein Semester Chemie studiert, bevor ich zur Physik gewechselt bin. Physik hatte mich zwar mehr interessiert, aber ich habe es mir nicht zugetraut. Doch dann habe ich beschlossen, das zu machen, was mich wirklich interessiert.
Warum haben Sie es sich nicht zugetraut?
Physik wurde oft unter den Glassturz des besonders Schwierigen, des besonders Unzugänglichen gestellt. Im Laufe des Studiums habe ich erfahren, dass das gar nicht den Tatsachen entspricht. In meiner Studienzeit pflegte ein Teil der Professoren ein ziemlich überhebliches Auftreten gegenüber den Studierenden. Das drückte die Stimmung. Es gab damals auch noch Professoren, die der Meinung waren, dass die Kombination Frauen und Physik nicht gut gehen könne. Doch solche Ansichten sind im Aussterben. Heute ist die Einstellung zu Frauen grundsätzlich anders. Ich war gerade auf einer Fachkonferenz in den USA. Die drei besten Vorträge haben Frauen gehalten, und sie wurden entsprechend gewürdigt.
Ist Ihnen das Studium leicht gefallen? Oder war es eine Herausforderung?
In den ersten eineinhalb Jahren war es sehr herausfordernd, da unser Mathematikunterricht weniger anspruchsvoll gewesen war als im naturwissenschaftlichen Gymnasium. Anfangs habe ich auch mit meinem Selbstbild gekämpft: ,,Ich bin ja nur ein Mädchen, ich kann das wahrscheinlich nicht so gut, ich muss mich da durchkämpfen."
Nach Ihrer Diplomarbeit gingen Sie nach München und schrieben dort Ihre Dissertation. Warum München?
Für die Diplomarbeit arbeitete ich an Hochtemperatursupraleitern und fuhr bereits auf Tagungen. Auf einer Tagung habe ich Rudi Hackl vom Institut für Tieftemperaturforschung in Garching bei München kennengelernt. Ich habe gezielt nach einem passenden Institut für die Dissertation gesucht und mich auch in Aachen und in Göteborg/Schweden vorgestellt. Doch ich habe mich für München entschieden, weil mir der Rudi Hackl am sympathischsten war und weil ich das Gefühl hatte, mit ihm könnte ich gut zusammenarbeiten und mich weiterentwickeln. Das hat sich als total richtig herausgestellt. Frauen suchen Arbeitsumfelder, in denen sie sich wohl fühlen. Am Anfang war ich die einzige Frau am Institut, unter 35 Männern, am Ende meiner Dissertation waren wir schon vier Frauen.
Nach Ihrer Dissertation gingen Sie in die Wirtschaft. Hätte es Sie nicht gereizt, an der Uni zu bleiben?
In München wäre es nicht möglich gewesen, da das Institut nur wenige permanente Stellen hatte. Ich hätte an die University of Stanford in den USA gehen können, dort hatte ich bereits eine Zusage für eine zweijährige Postdoc-Stelle. Danach hätte ich weitere Postdoc-Positionen annehmen müssen, bis ich irgendwann eine Assistenzprofessur bekommen hätte. Das hat mich nicht gereizt. Unter diesen Umständen wäre es auch schwierig gewesen, eine eigene Familie zu haben. Zu jener Zeit hat Siemens Halbleiter in Villach mehrere Stellen ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und bin dort eingestiegen. Einige Jahre später wurde aus diesem Unternehmen Infineon Technologies AG.
Woran haben Sie bei Siemens Halbleiter beziehungsweise bei Infineon gearbeitet?
Ich war Entwicklungsingenieurin im Bereich Zuverlässigkeit. Ich habe beispielsweise an der Entwicklung von hochintegrierten Leistungstransistoren für die Automobilelektronik mitgearbeitet und Zuverlässigkeitstestverfahren auf Waferlevel entwickelt.
Nach sieben Jahren sind Sie an das Joanneum Research Institut in Weiz gewechselt. Aus welchen Gründen?
Ich habe in dieser Zeit zwei Kinder bekommen und bei Infineon in Graz einen Telearbeitsplatz gehabt. Zwei Tage pro Woche war ich in Villach, den Rest der Zeit in Graz. Da ich aber Zuverlässigkeitsingenieurin mit einem eigenen Labor in Villach war, war das Pendeln auf Dauer nicht empfehlenswert, zumindest nicht für eine experimentelle Arbeit. Mich hat auch gestört, dass man in einem Konzern nur ein kleines Rädchen im Werk ist. Man ist immer mit einer ganzen Kette von Vorgesetzten konfrontiert. Ich konnte schon etwas eigenständig entwickeln, ich habe zwei Papers geschrieben und war auf Tagungen. Man verdient in der Industrie auch sehr gut, und der Support der Mitarbeiter, etwa die Organisierung der Dienstreisen, ist angenehm. Aber letztlich geht es in einem Konzern immer um die Frage, ob man Karriere machen wird, und das wäre mir auf Dauer als einzige Perspektive zu langweilig gewesen. Als ich bei meinem zweiten Kind in Karenz war, hörte ich, dass Leute für den Aufbau eines Forschungsinstituts in Weiz gesucht wurden. Einer der Schwerpunkte sollte organische Elektronik sein. Ich kam aus dem Halbleiterbereich, ich hatte Industrieerfahrung, ich war eine recht ideale Kandidatin. So habe ich in Weiz begonnen.
Was machen Sie derzeit?
Ich bin Leiterin des Forschungsschwerpunkts organische Elektronik am Institut für nanostrukturierte Materialien und Photonik. Mein Spezialgebiet ist organische Elektronik und gedruckte, flexible Elektronik.
Was ist organische Elektronik?
In der organischen Elektronik werden elektronische Schaltungen aus organischen Verbindungen auf flexiblen Trägermaterialien hergestellt. Die Grundlage hierzu sind Kunststoffmaterialien, die halbleitende Eigenschaften haben und dadurch Silizium ersetzen können. Nachdem diese Materialien in Labors synthetisiert werden, können sie wahlweise auch mit anderen Funktionen versehen werden, also auch sensibel gegenüber bestimmten Stoffen oder Gasen reagieren beziehungsweise Druck- und Temperaturempfindlichkeiten aufweisen. Der wesentliche Vorteil der organischen Elektronik ist, dass sie sehr kostengünstig auf Folien, Papier oder auch Textilien im Druckverfahren hergestellt werden kann. Damit wird es möglich, Bauelemente auf großen, beliebig geformten, ja sogar dehnbaren Materialien zu integrieren - beispielsweise rollbare Displays, intelligente Kleidung, solarzellbeschichtete Fassaden oder flexible RFID-Tags. Darüber hinaus erweitern die Zusatzfunktionalitäten der Materialien das Anwendungsspektrum bis in den Bereich der Optik, Diagnostik und Sensorik. Von der Umweltbilanz her ist die organische Elektronik Siliziumprozessen vorzuziehen, weil die Herstellungsverfahren bei geringeren Temperaturen, niedrigerem Energieverbrauch und mit weniger giftigen Stoffen erfolgen.
An unserem Institut forschen wir an organischen Transistoren und Schaltkreisen, organischen Photozellen und organischen Sensoren. Eine rein elektronische Anwendung, mit der wir uns beschäftigen, sind flexible RFID-Tags, die eine berührungslose, kabellose Kommunikation ermöglichen. Diese Tags, auch Transponder genannt, können auf eine Verpackungsfolie gedruckt werden und erlauben es, ein Produkt von der Herstellung über den Transport bis zum Konsumenten verfolgen zu können. Auf den organischen Chips könnten beispielsweise das Verfalldatum der Produkte und deren Preis gespeichert sein, oder sie könnten Sicherheitsmerkmale zum Produktschutz, Namensschutz und Qualitätsschutz enthalten.
Welche Produkte sind bereits am Markt?
Die organische Elektronik ist noch nicht ausgereift - es gibt eine Reihe von Forschungsprojekten, aber noch wenige Produkte am Markt. Erste Beispiele sind Displays auf Basis organischer Leuchtdioden für mobile elektronische Endgeräte, etwa die neueste Handygeneration und E-Books, organische Solarzellen und große, vielfarbige Beleuchtungskörper. Es gibt auch schon Oled-Farbfernseher. Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Farbbrillanz aus und haben einen äußerst geringen Energieverbrauch.
Welche Forschungsprojekte leiten Sie derzeit?
Ich habe gerade alle Projektleitungen an meine MitarbeiterInnen übertragen. Ich wollte mich etwas freispielen, um Koordinationsaufgaben zu übernehmen und mich um die Akquisition neuer Projekte zu kümmern. Es ist auch gut für die jüngeren MitarbeiterInnen, wenn sie Verantwortung für Projekte übernehmen. Wir arbeiten an mehreren europäischen und einigen nationalen Projekten: Zu den europäischen Projekten zählen 3Plast, Polaric und PolyNet. Bei 3Plast geht es um die Entwicklung großflächig hergestellter integrierter Polymersensoren. Bei Polaric, einem neuen Projekt, das im Jänner startet, geht es um die Entwicklung und Herstellung von organischen Schaltkreisen, wie sie für kostengünstige RFID-Tags und LED-Displays benötigt werden. Bei einem von der Österreichischen Nanoinitiative geförderten Projekt wird an hochauflösenden Prägetechniken - Nanoimprint Lithographie - geforscht. Und schließlich bauen wir in einem Nachbargebäude gerade eine Pilotanlage für ein Rolle-zu-Rolle-Verfahren, wo die kostengünstige Herstellung von hochauflösenden Strukturen auf großen Flächen erprobt wird.
Was ist der Vorteil von organischer Elektronik im Vergleich zu Silizium?
Am Anfang ging es nur darum, dass das Herstellungsverfahren - Elektronik wie Farbe zu drucken - viel billiger sein könnte als die Herstellung von Silizium-basierten Schaltkreisen. Nun stellt sich heraus, dass organische Elektronik auch viel umweltschonender hergestellt werden kann. Dieser Vorteil ist uns erst mit der Zeit bewusst geworden. Das beinhaltet natürlich, dass man auf giftige Lösungsmittel wie Chlorbenzol verzichtet. Am Institut hier machen wir das sowieso. Erstens soll niemand mit solchen Produkten arbeiten, auch in Hinblick auf Schwangerschaften, und zweitens mag es auch keiner.
Arbeiten am Institut viele Forscherinnen?
Ja, und zwar auch als Projektleiterinnen. Das führt oft zu ungewöhnlichen Situationen, wenn zwei oder drei Frauen von uns zu Projektbesprechungen mit europäischen Partnern fahren, die nur Männer im Team haben. In einem Projekt besteht unser Team aus zwei Projektleiterinnen, eine davon hat wiederum eine Frau als Mitarbeiterin. Auch in der Antragsphase des europäischen Polaric-Projektes sind wir oft zu zweit - zwei Frauen - zu den Meetings gefahren, während von den anderen Teams meist Männer kamen, die manchmal eine Frau dabei hatten. Am Anfang ist das für die Partner oft irritierend, aber mit der Zeit spielt das überhaupt keine Rolle mehr.
Zieht die Präsenz von Frauen in einem Institut andere Frauen an?
Ich glaube schon. Dadurch entsteht ein Klima, in dem sich Frauen wohl fühlen. Wir haben auch einige weibliche Lehrlinge, Physiklaborantinnen, am Institut. Wenn man Mädchen und junge Frauen gewinnen will, muss das Klima ein bisschen lockerer sein, da muss auch gekichert werden dürfen. Weil es schon Mädchen am Institut gibt, kommen weitere dazu. Mit den Mädchen machen wir sehr gute Erfahrungen. Burschen können in diesem Alter auch gar nicht mit den Mädchen mithalten. Bei den Bewerbungen zeigt sich immer ein eklatanter Unterschied, was Ernsthaftigkeit und Genauigkeit betrifft.
Danke für das Interview!
Das Interview führte Margarete Endl.
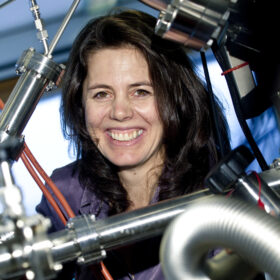
Kontakt
Letzte Aktualisierung: 08.04.2021


















